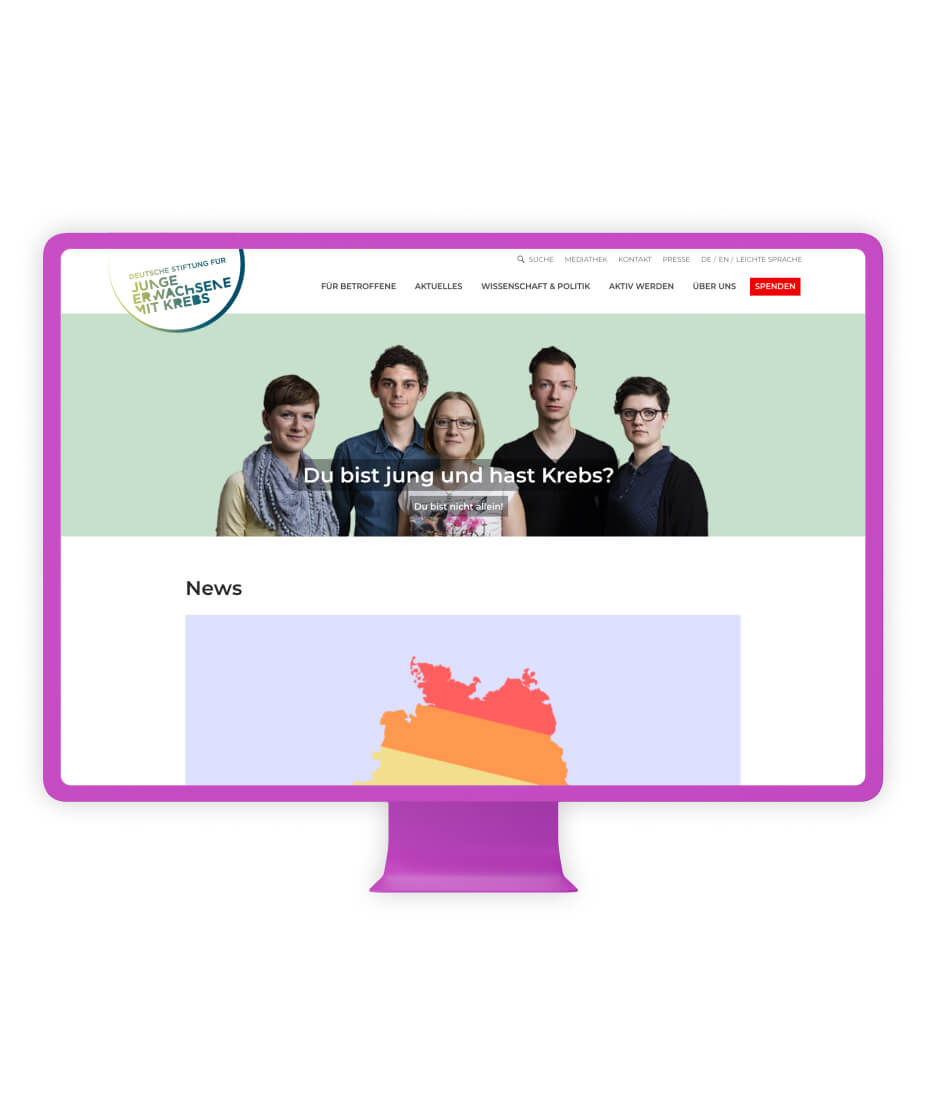Während die Krankschreibung sofort nach der Diagnose den Arbeitgeber:innen vorgelegt werden muss, sind die Mitarbeiter:innen nicht verpflichtet, ihre Krebserkrankung als Grund offenzulegen. Die Entscheidung hängt von der individuellen Situation und nicht zuletzt auch vom persönlichen Vertrauensverhältnis ab. Manche Patient:innen sind in Sorge, dass ihnen der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin aufgrund möglicherweise langer Fehlzeiten oder mangelnder Belastbarkeit kündigen könnte. Dies ist jedoch nur im Sonderfall möglich. Generell sind die Arbeitgeber:innen an gesetzliche Vorschriften gebunden, die rechtlich nachprüfbare Gründe für eine Kündigung voraussetzen. Eine Kündigung aufgrund von Krankheit ist demnach im Rahmen „personenbedingter Gründe“ möglich, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
- Negative Gesundheitsprognose
Zum Zeitpunkt der Kündigung gibt es objektive Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig mit weiteren Erkrankungen und damit Fehlzeiten im bisherigen Umfang zu rechnen ist.
- Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen
Dies ist der Fall, wenn die Krankheit und die oben genannte negative Gesundheitsprognose der Arbeitnehmer:innen beispielsweise zu Störungen im Betriebsablauf oder zu deutlichen wirtschaftlichen Belastungen der Arbeitgeber:innen (zum Beispiel zusätzliche Lohnkosten) führen.
- Interessenabwägung
Es wird geprüft, ob die Einschränkungen, die Arbeitgeber:innen durch die Krankheit der Arbeitnehmer:innen entstehen, noch zumutbar sind.
Akzeptieren die Arbeitnehmer:innen die Kündigung nicht, müssen sie innerhalb von drei Wochen, nachdem sie die schriftliche Kündigung erhalten haben, eine Kündigungsschutzklage einreichen. Andernfalls ist die Kündigung rechtsgültig.
Im Falle einer Kündigung ist es sinnvoll, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zu Rate zu ziehen, um die Möglichkeiten – beispielsweise Kündigungsschutzklage, gegebenenfalls Abfindung – zu eruieren und entsprechende Maßnahmen im rechtlich vorgegebenen Zeitrahmen einzuleiten.
Ausnahmen bilden Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeiter:innen und Beschäftigte mit Schwerbehinderung. In sogenannten Kleinbetrieben dürfen die Arbeitgeber:innen in der Regel jederzeit ordentlich und unter Einhaltung der vereinbarten Fristen kündigen. Dies kann auch ohne Angabe von Gründen geschehen.
Schwerbehinderte (Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent) unterstehen einem besonderen Schutz: Eine Kündigung ist nur mit Zustimmung des Integrationsamtes – einer Behörde, die für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Arbeitsleben zuständig ist – möglich.